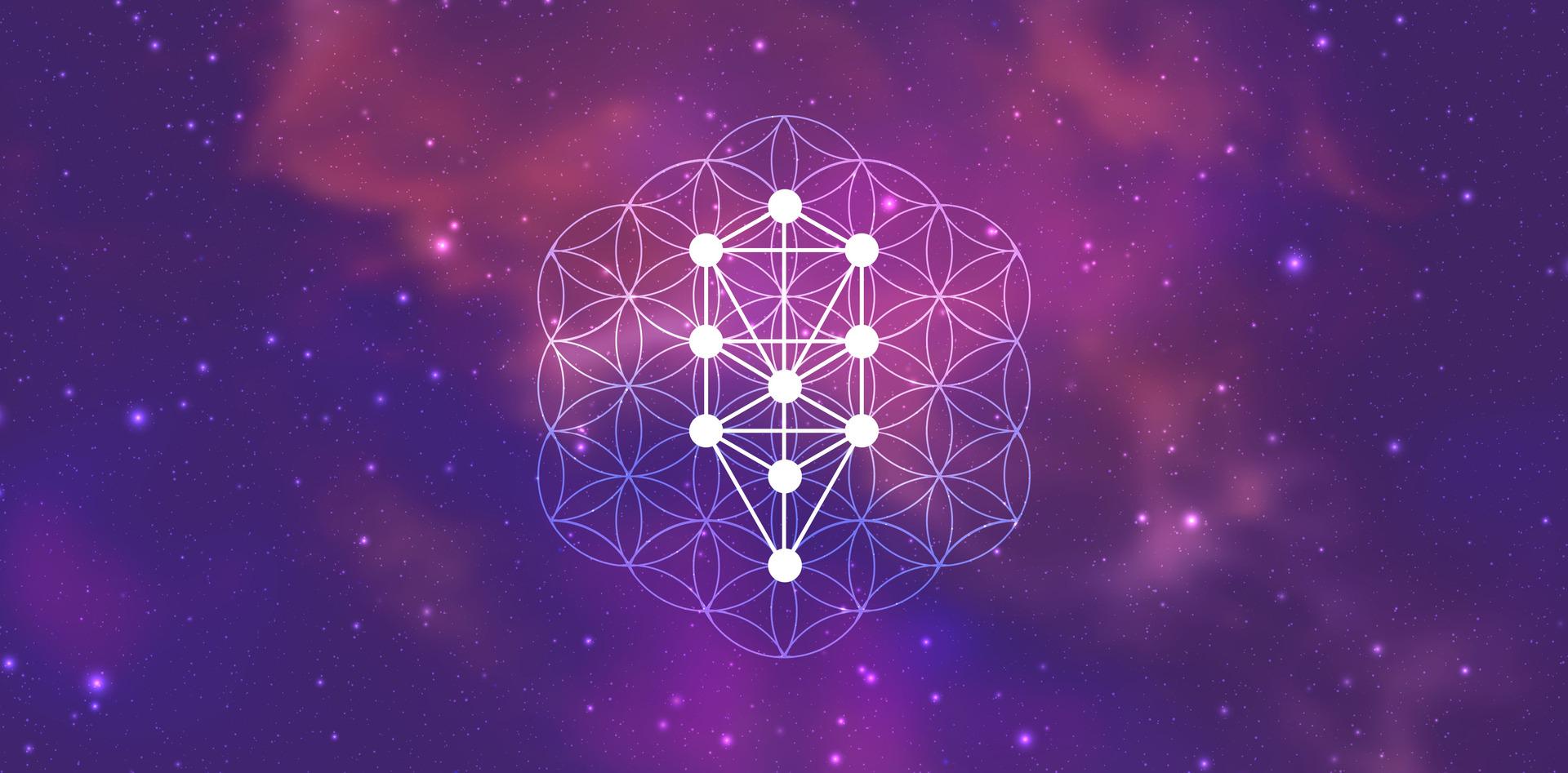Die sieben Namen des Windes

Die sieben Namen des Windes
Es hieß, der Wind habe sieben Namen, doch nur wer drei davon kenne, könne eine Bitte an die Welt richten, ohne sie zu verletzen. Alaric lernte den ersten Namen, als er Kind war und seine Mutter ihm am Fenster den Regen erklärte: Sural—der Wind, der die Ränder weich macht. Den zweiten lernte er auf See: Bareth—der Wind, der dich prüft, nicht um dich zu brechen, sondern um die Form zu finden, in der du halten kannst. Den dritten entdeckte er spät, in einer Zeit, in der es in ihm still geworden war wie in Häusern nach einem Fest: Nim—der Wind, der in leeren Zimmern singt.
Als seine Frau starb, blieb Alaric zurück in einem Haus, das plötzlich groß war. Freunde kamen, brachten Suppe, Blumen, Sätze, die wie Decken sein sollten. Doch nachts saß er am Küchentisch und hörte den Wind in den Bäumen. Er hörte nichts von Trost. Aber er hörte Namen, und das war genug, um nicht unterzugehen.
Eines Tages erreichte ihn ein Brief einer Nichte aus der Stadt, die er kaum kannte. „Komm“, schrieb sie. „Es gibt Arbeit an der alten Orgel in der Kapelle. Niemand weiß, wie man sie zum Sprechen bringt. Vielleicht weißt du es.“ Alaric verstand etwas von Händen, Holz und Geduld. Er ging.
Die Kapelle lag zwischen zwei Straßen, die einander nicht mochten, und wenn die Sonne tief stand, glänzten die Fenster wie Wasser. Die Orgel war verstaubt, manche Pfeifen verbeult. Alaric strich über das Holz wie über einen Rücken, den man trösten will. „Wir versuchen es langsam“, sagte er, und niemand fragte, zu wem er sprach.
Er begann mit den Ventilen, den Lederbälgen, den Scharnieren aus verzweifeltem Messing. Während seine Hände arbeiteten, lauschte er auf den Wind, der durch die offenen Fenster kam. Im Frühling trug er den Duft von Linden, im Herbst schmeckte er nach Metall. Alaric merkte, wie der Wind nicht nur draußen war. Er war zwischen den Pfeifen, im Atem des Raumes. Er hatte einen vierten Namen: Eiel—der Wind, der aus dem, was schweigt, Stimmen macht.
Als die Orgel wieder atmete, lud die Nichte die Nachbarschaft zu einem stillen Konzert. Kein Programm, keine Ankündigungen. Alaric setzte sich an die Tasten. Er war kein großer Spieler; er wusste nur, wie man sich nicht zwischen die Noten stellt. Er spielte einen Choral, der mehr Lücke als Linie war. Der Wind nahm die Lücken an sich, füllte sie nicht, sondern ließ sie klingen. Die Leute standen da, manche mit geschlossenen Augen, und dachten an das, was sie geliebt hatten und verloren. In ihren Gesichtern war kein Schmerz, sondern Anerkennung.
Nach dem letzten Ton blieb Alaric sitzen. Er spürte den fünften Namen: Tara—der Wind, der über die Stirn streicht, wenn man sagt: „Ich kann nicht mehr“ und entdeckt, dass man doch kann. Später, draußen vor der Kapelle, fragte ihn die Nichte, ob er bleiben wolle. Er nickte. Das Haus musste nicht mehr groß sein; groß ist nur, was man mit niemandem teilt.
Im Winter, als Schnee die Stadt leiser machte, fand Alaric den sechsten Namen: Vann—der Wind, der nur in der Nähe hört. Er weht, wenn zwei einander zuhören, ohne zu widersprechen. Er weht, wenn man einem Kind erklärt, dass Sterben nicht das Gegenteil von Leben ist, sondern sein anderer Flügel. Er weht, wenn man behutsam eine Tür schließt.
Den siebten Namen hörte er nicht. Namen wie dieser kann man nicht hören; man wird von ihnen gehört. Manche sagen, er sei Sol, andere sagen, er habe keinen Laut. Alaric wusste nur: Eines Abends, als er die Kapelle abschloss, stand ein Mädchen im Eingang. „Meine Mutter sagt, du kennst den Wind“, sagte sie. „Kannst du mir zeigen, wie man ihn bittet?“ Alaric lächelte, legte den Finger an die Lippen. „Sag deinen Namen“, sagte er. „Und dann höre, wie der Wind ihn ausspricht. Wenn du merkst, dass er ihn schon kannte, bevor du ihn nanntest—dann bitte.“
In der Nacht wehte ein milder, nahezu unsichtbarer Luftzug durch die Stadt. Jemand schlief zum ersten Mal durch, jemand schrieb einen Brief zu Ende, den er Jahre begonnen hatte. Alaric saß am Fenster und verstand: Manche Bitten sind keine Forderungen. Sie sind Erinnerungen, die man der Welt an sich selbst schenkt.
Verwandte Blog -Beiträge

Die faszinierende Welt der Dämonologie: Ein kraftvoller Einblick in die Lehre von den Dämonen und ihrem Einfluss auf die Menschheit!
Read More