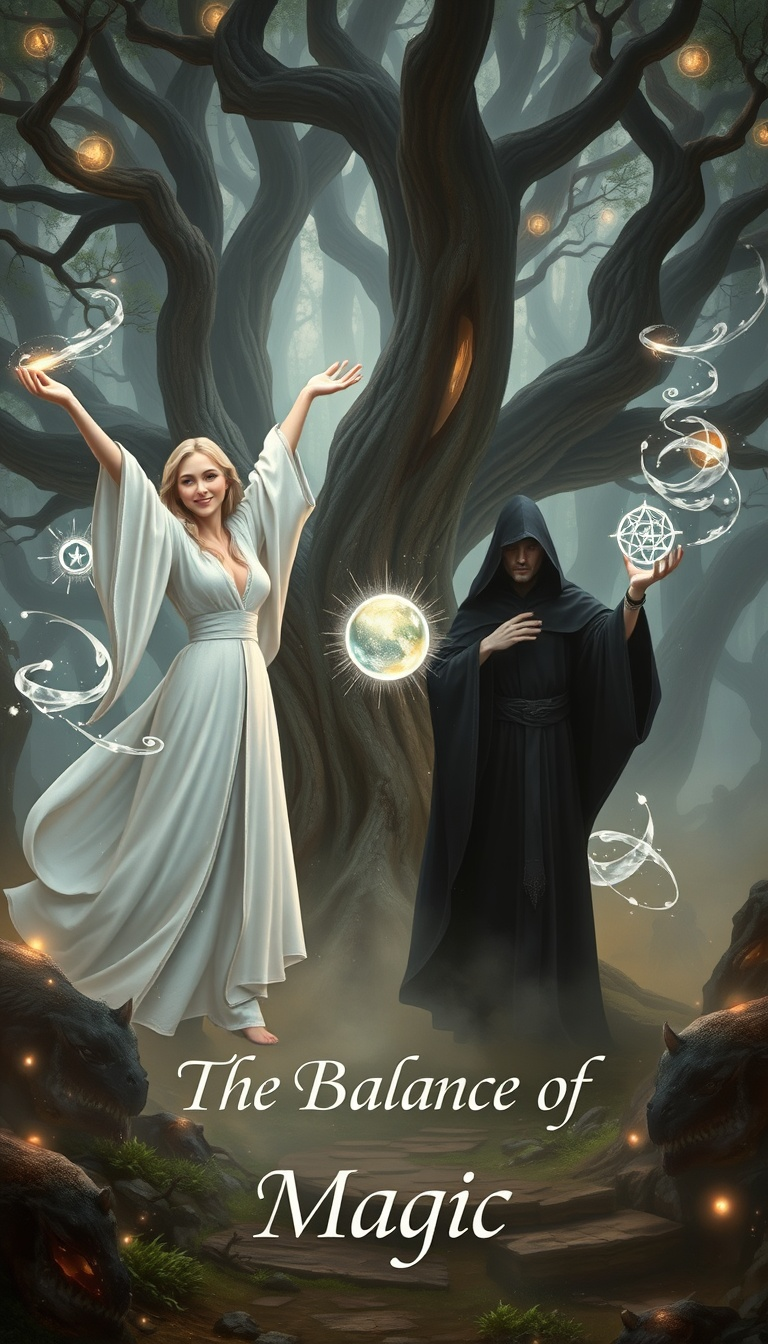Die Werkstatt der stillen Uhren

Die Werkstatt der stillen Uhren
Im Hinterhof eines Hauses mit bröckelndem Putz lag eine Werkstatt, in der Uhren stillstanden. Nicht weil sie kaputt waren, sondern weil ihre Besitzer darum gebeten hatten. Der Uhrmacher hieß Edda, und sie war die Art Mensch, die Zeit nicht misst, sondern begleitet. Man brachte ihr Uhren, die an Tagen stehen bleiben sollten, die man nicht vergessen wollte: der erste Kuss, der letzte Blick, die Stunde der Geburt, der Moment der Vergebung. Edda stellte die Uhren ab, nicht um Zeit zu verweigern, sondern um ihr einen Ort zu geben.
Eines Abends kam ein Mann herein, dessen Anzug müde war und dessen Augen die Farbe der Dämmerung hatten. In seiner Hand eine Taschenuhr, schwer, golden, zu oft geputzt. „Stellen Sie sie still“, sagte er, „auf zwölf nach neun.“ Edda hob die Augenbraue. „Der Moment, als sie ging“, erklärte er, und da war keine Bitterkeit, nur ein Meer. „Ich vergesse die Geräusche“, fügte er hinzu. „Die Tasse, die leise den Tisch berührt, ihr Atem, der einmal noch…“ Er brach ab.
Edda nahm die Uhr, öffnete den Deckel. Ein kleinster Haarflaum klebte noch am Glas, vielleicht von damals, vielleicht von immer. „Ich kann sie stillstellen“, sagte sie. „Oder ich kann dir zeigen, wie man weitergeht, ohne die Uhr zu verraten.“ Er sah sie an, ratlos und hoffnungslos zugleich. „Wie soll das gehen?“
Edda führte ihn in den hinteren Raum, wo die stillen Uhren lagen. Es waren viele. Manche zeigten Zeiten, die offensichtlich festlich waren, andere banale Minuten. „Siehst du“, sagte sie, „all diese Menschen haben gesagt: Hier. Hier will ich bleiben. Das ist schön. Aber Zeit ist nicht nur Bewegung. Zeit ist auch Nähe. Wenn du diese Uhr stillstellst, wird sie dir treu sein. Aber du wirst dich bewegen, egal wie du dich wehrst. Vielleicht…“—sie lächelte, und ihr Lächeln war kein Trost, sondern ein Vorschlag—„…stellen wir zwei Uhren? Eine bleibt, die andere geht mit.“
Sie suchten gemeinsam eine zweite Uhr aus, eine einfache, mit einem leichten Ticken, das an Herzschlag erinnerte. Edda stellte die goldene auf zwölf nach neun, schloss den Deckel. Dann nahm sie die einfache und bat den Mann, ihr einen anderen Zeitpunkt zu nennen. Er überlegte lange. „Heute Abend“, sagte er dann. „Wenn ich den Mut finde, die Wohnung aufzuäumen.“ Edda notierte die Zeit, lächelte: „Dann wird diese Uhr gehen, wenn du gehst. Und wenn du stehst, steht sie mit dir.“
Er kam in den nächsten Wochen öfter. Er brachte Kaffee, setzte sich auf die Werkbank. Edda ließ ihn erzählen, nicht in langen Reden, sondern in Sätzen, die wie Schrauben waren: klein, notwendig. Er berichtete vom Aufräumen, vom ersten Lachen, das kam wie ein Vogel, der kurz auf dem Fensterbrett sitzt. Er erzählte vom Blick aus dem Fenster, den er nie beachtet hatte, und davon, wie schön die Bäume sind, wenn sie nichts beweisen müssen.
Einmal brachte er die goldene Uhr wieder. „Ich glaube, sie ist zu schwer geworden“, sagte er. Edda nickte. „Dann legen wir sie hin. Nicht weg. Hin.“ Sie legten die Uhr in eine Schale aus Samt, die Edda für solche Momente hatte. „Was ist, wenn ich vergesse?“, fragte er. „Dann liest du in dir“, sagte Edda. „Erinnerungen sind nicht in Uhren. Uhren sind nur die freundlichen Wächter an der Tür.“
Die Werkstatt blieb ein Ort, an dem man die Zeit nicht bekämpfte, sondern ihr Händchen hielt. Menschen kamen, stellten etwas ab, nahmen etwas mit. Edda weckte Uhren, wenn jemand wieder bereit war. Und manchmal, wenn der Abend warm war und irgendwo eine Geige übte, hörte man in dem Hinterhof ein Chor aus sehr leisen Ticken. Es klang wie das, was übrigbleibt, wenn Schmerz seinen Mantel ablegt: Gegenwart.